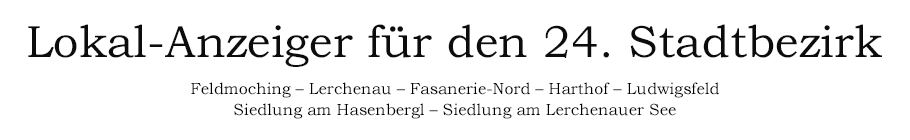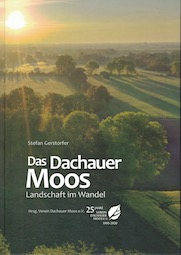 Der Verein Dachauer Moos besteht seit inzwischen über 25 Jahre. Gegründet wurde er 1995, um den naturnahen Freiraum im östlichen Dachauer Moos und Schwarzhölzl zu sichern und weiterzuentwickeln. Inzwischen zählen elf Gemeinden, Landkreise sowie Städte zu seinen Mitgliedern, denn Arten- und Naturschutz endet nicht an den Gemeindegrenzen. Und der Tätigkeitsbereich des Vereins erstreckt sich nun auch auf das westliche Dachauer Moos. 2020 hat der Verein Dachauer Moos zu seinem 25. Geburtstag ein schönes Buch herausgebracht: „Das Dachauer Moos – Landschaft im Wandel“.
Der Verein Dachauer Moos besteht seit inzwischen über 25 Jahre. Gegründet wurde er 1995, um den naturnahen Freiraum im östlichen Dachauer Moos und Schwarzhölzl zu sichern und weiterzuentwickeln. Inzwischen zählen elf Gemeinden, Landkreise sowie Städte zu seinen Mitgliedern, denn Arten- und Naturschutz endet nicht an den Gemeindegrenzen. Und der Tätigkeitsbereich des Vereins erstreckt sich nun auch auf das westliche Dachauer Moos. 2020 hat der Verein Dachauer Moos zu seinem 25. Geburtstag ein schönes Buch herausgebracht: „Das Dachauer Moos – Landschaft im Wandel“.
Das Dachauer Moos hat sich in den letzten Jahrhunderten stark gewandelt, wie das 240 Seiten umfassende Buch mit weit über 300 eindrucksvollen Fotos (ein Teil davon stammt aus dem Fotowettbewerb „moosARTig“, den der Verein 2016 im Rahmen des bayerischen Biodiversitätsprojekts „Neues Leben im Dachauer Moos“ auslobte), Bildern, Grafiken und historischen Karten belegt. Obwohl das Moos seit dem 19. Jahrhundert durch den intensiven Torfabbau, die umfangreiche Entwässerung und die Regulierung der Bachläufe sowie in unserer Zeit durch die Olympia-Ruderregatta, die dem Moos buchstäblich bis heute das Wasser abgräbt, sowie nicht zuletzt durch den enormen Siedlungsdruck sehr viel von seiner einstigen Urwüchsigkeit eingebüßt hat, ist es trotzdem noch eine attraktive und wertvolle Landschaft. Die es zu erhalten gilt – als Lebens- und Erholungsraum für die in immer engeren Verhältnissen lebenden Stadtmenschen, als Refugium für die heimische Tier- und Pflanzenwelt und nicht zuletzt als wichtiger Faktor für den Klimaschutz.
„Die Bücher müssen
unters Volk“
Am Donnerstag, den 17. Dezember stellten Peter Felbermeier, Bürgermeister von Haimhausen und 1. Vorsitzender des Vereins Dachauer Moos, Vereins-Geschäftsführer Robert Rossa sowie Autor Stefan Gerstorfer das druckfrische Buch in einer Online-Präsentation vor.
Autor Gerstorfer ist gebürtiger Dachauer und studierter Landschaftsarchitekt. Er macht als selbständiger Grafiker, Zeichner, Texter und Fotograf seine Leidenschaft zum Beruf und gestaltet seit 20 Jahren Medien vornehmlich für Kunden aus dem „grünen“ Bereich: Kommunen, Institutionen, Landschaftspflege- und Naturschutzverbände. Schade nur: Sein neues Werk wird zumindest in der ersten Auflage nicht käuflich auf dem Buchmarkt erhältlich sein. Die 4.000 Exemplare wurden unter den Mitgliedern des Vereins aufgeteilt, die das Buch nun überreichen können an Gemeinde- und Stadträte, Bezirksausschussmitglieder, Naturschutzbehörden und Neubürger, Schulen und Bibliotheken, an Ehrenamtliche, einschlägige Heimatvereine, Ortschronisten oder auch an Hochzeiter als Präsent sowie als kleine Anerkennung an die Fotografen dieses Buchs. Finanziert wurde es schließlich über die Mitgliedsbeiträge und der Bezirk von Oberbayern gewährte einen Zuschuss von 3.500 €.
„Damals ist das Moor noch zehn Kilometer breit gewesen …“
 Das neue Buch erzählt in kurzen, meist zweiseitigen Kapiteln konzentriert und allgemeinverständlich, um der knappen Aufmerksamkeitsspanne heutiger Leser Rechnung zu tragen, von der Entstehung und der Geschichte der Kulturlandschaft Dachauer Moos, das weiter gefasst ist als der Name „Dachau“ suggeriert: Es erstreckt sich vom Aubinger und Olchinger Moos, vom Maisacher und Bergkirchner Moos über das Krenmoos bei Karlsfeld und natürlich auch die Feldmochinger Flure bis hin zum Inhauser und Freisinger Moos.
Das neue Buch erzählt in kurzen, meist zweiseitigen Kapiteln konzentriert und allgemeinverständlich, um der knappen Aufmerksamkeitsspanne heutiger Leser Rechnung zu tragen, von der Entstehung und der Geschichte der Kulturlandschaft Dachauer Moos, das weiter gefasst ist als der Name „Dachau“ suggeriert: Es erstreckt sich vom Aubinger und Olchinger Moos, vom Maisacher und Bergkirchner Moos über das Krenmoos bei Karlsfeld und natürlich auch die Feldmochinger Flure bis hin zum Inhauser und Freisinger Moos.
Bei diesem Streifzug durchs Moos wird dem Leser kompakt und gut lesbar die regionale Vielfalt vor Augen geführt und er erhält Anregungen, wohin er, nicht nur in Zeiten von Corona, seine Schritte lenken kann, um in der Weite der Landschaft noch ein wenig zu erahnen vom einstigen Charme, der Wildheit und Abgeschiedenheit des Mooses, das um 1900 Künstler wie Adolf Hölzel, Arthur Langhammer und Emil Hansen, der sich später Nolde nannte, aber auch „Malweiber“ wie Emmi Walther, Maria Langer-Schöller und Ida Kerkovius in seinen Bann zog.
So kann der Leser in Gedanken etwa mit dem Maisacher Moos eines der größten noch zusammenhängenden Niedermoorkomplexe der Münchner Ebene betreten, das sich zwischen Maisach und Bergkirchen erstreckt und wo das Moos trotz Entwässerung und Abtorfung im 20. Jahrhundert noch Moor ist – mit Torfmächtigkeiten von ein bis zwei Metern – und ein reich strukturiertes Mosaik aus Feucht- und Moorwäldern sowie Streuwiesen bildet, auf denen urtümliche, rückgezüchtete Heckrinder bei der Pflege der wertvollen feuchten Wiesen mithelfen. Wir lernen das Palsweiser Moos und das Fußbergmoos kennen, letzte Refugien für Flora und Fauna, die wie die buschhohe Strauch-Birke, der Kamm-Wurmfarn und der Riedteufel – trotz seines gefährlich klingenden Namens ein harmloser Schmetterling – Relikte aus der letzten Eiszeit sind.
Auch Feldmochings Flure dürfen nicht fehlen
 Das Kapitel „Drunter & drüber – kreuz und quer“ streift Feldmoching und führt in die weite Feldflur Richtung Schwarzhölzl und Regattastrecke an den Würmkanal, der schon seit über 400 Jahren Wasser von der Würm in Karlsfeld zum Schleißheimer Schloss umleitet. Natürlich darf auch die Regattastrecke, der tiefste Punkt Münchens, nicht fehlen. Schließlich entwässert der riesige Grundwassertrog mit einer Spiegelfläche von 312.000 qm und einer Wassertiefe von 3,5 m bis heute große Teile des östlichen Dachauer Mooses. Für den gewaltigen Aushub des Trogs mussten seinerzeit 2,8 Mio. Kubikmeter Erdreich umgelagert werden – aufgeschüttet auf einer einst artenreichen Mooswiese im Schwarzhölzl, die Forstbehörden und das Münchner Kommunalreferat damals ignorant als „forsttechnisch nicht wertvoll“ abqualifiziert hatten. Anmodelliert entstand der Schwarzhölzlberg. Ob ein solch gravierender Eingriff in ein sensibles Ökosystem heute noch so „durchgezogen“ werden könnte? Eine Seite weiter lässt sich nachlesen, welche negative Auswirkungen auf die Vegetation die voranschreitende Grundwasserabsenkung um bis zu 2 m, stark befördert durch den Bau der Ruderregatta, etwa im einst artenreichen Kiefern- und Birkenwald Schwalzhölzl, 1922 noch als Zwischenmoorwald eingestuft, mit sich brachte. Auch wenn das Schwarzhölzl natürlich auch heute noch ein Hort der Ruhe und der Artenvielfalt ist!
Das Kapitel „Drunter & drüber – kreuz und quer“ streift Feldmoching und führt in die weite Feldflur Richtung Schwarzhölzl und Regattastrecke an den Würmkanal, der schon seit über 400 Jahren Wasser von der Würm in Karlsfeld zum Schleißheimer Schloss umleitet. Natürlich darf auch die Regattastrecke, der tiefste Punkt Münchens, nicht fehlen. Schließlich entwässert der riesige Grundwassertrog mit einer Spiegelfläche von 312.000 qm und einer Wassertiefe von 3,5 m bis heute große Teile des östlichen Dachauer Mooses. Für den gewaltigen Aushub des Trogs mussten seinerzeit 2,8 Mio. Kubikmeter Erdreich umgelagert werden – aufgeschüttet auf einer einst artenreichen Mooswiese im Schwarzhölzl, die Forstbehörden und das Münchner Kommunalreferat damals ignorant als „forsttechnisch nicht wertvoll“ abqualifiziert hatten. Anmodelliert entstand der Schwarzhölzlberg. Ob ein solch gravierender Eingriff in ein sensibles Ökosystem heute noch so „durchgezogen“ werden könnte? Eine Seite weiter lässt sich nachlesen, welche negative Auswirkungen auf die Vegetation die voranschreitende Grundwasserabsenkung um bis zu 2 m, stark befördert durch den Bau der Ruderregatta, etwa im einst artenreichen Kiefern- und Birkenwald Schwalzhölzl, 1922 noch als Zwischenmoorwald eingestuft, mit sich brachte. Auch wenn das Schwarzhölzl natürlich auch heute noch ein Hort der Ruhe und der Artenvielfalt ist!
„Es ist wichtig, die Reste dieser großartigen Landschaft zu erhalten“
Autor Gerstorfer hat viel Zeit in das Projekt investiert, um historische Quellen durchzuarbeiten und alte wie neue Fotos (oft per Fotodrohne aus ungewöhnlichen Perspektiven!) zusammenzustellen, damit das Moos in seiner vielfältigen Bedeutung für die Menschen (wieder) ins Bewusstsein rückt und sein Wert und seine Schönheit erlebbar werden. Das Buch zeigt aber auch die Herausforderungen auf, vor denen der Verein steht, und benennt wichtige Bausteine für das Moos der Zukunft, damit auch nachfolgende Generationen noch eine lebens- und liebenswerte Landschaft, reich an Flora an Fauna, vorfinden können. Denn nur wer die Landschaft wertschätzt und erkennt, welch Naturjuwel vor seiner Haustüre verloren gegangen ist, der wird sich in Zukunft auch für sie einsetzen. Das Buch in seinem Facettenreichtum, informativ und optisch schön aufbereitet, leistet dazu gewiss einen wertvollen Beitrag.