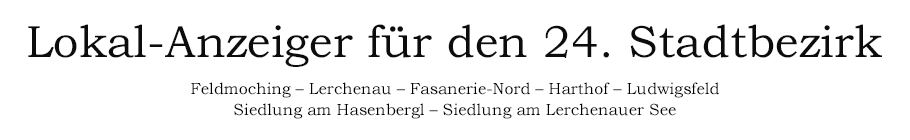Die Corona-Zeit mit ihren restriktiven Maßnahmen hatte auch positive Seiten. Menschen hatten plötzlich mehr Zeit für sich, für die Familie, für Hobbys … Vater und Sohn Niedermeier aus der Fasanerie brachten in der Zeit zwei Hammondorgeln wieder zum Klingen. Inzwischen hat Sohn Quirin ein Kleingewerbe angemeldet, weil sich aus der ganzen Welt Besitzer von defekten Hammondorgeln bei ihm melden und seine Hilfe erbitten. Unser Interview musste, kaum begonnen, der Herr Papa weiterführen, weil ein Grazer Kunde Quirin dringend zu sprechen wünschte. Im September ist der 22-Jährige wieder in den USA auf einer vierwöchigen Reparaturtour.
Die Corona-Zeit mit ihren restriktiven Maßnahmen hatte auch positive Seiten. Menschen hatten plötzlich mehr Zeit für sich, für die Familie, für Hobbys … Vater und Sohn Niedermeier aus der Fasanerie brachten in der Zeit zwei Hammondorgeln wieder zum Klingen. Inzwischen hat Sohn Quirin ein Kleingewerbe angemeldet, weil sich aus der ganzen Welt Besitzer von defekten Hammondorgeln bei ihm melden und seine Hilfe erbitten. Unser Interview musste, kaum begonnen, der Herr Papa weiterführen, weil ein Grazer Kunde Quirin dringend zu sprechen wünschte. Im September ist der 22-Jährige wieder in den USA auf einer vierwöchigen Reparaturtour.
Lange Jahre hatte der Vater, Hard-Rock-Fan à la Deep Purple, dem Sohn vorgeschwärmt vom coolen Klang einer Hammondorgel. Weil aber eine vollständig überholte Hammondorgel in USA teuer (10.000 bis 15.000 $) und in Deutschland „unbekommbar“ war, blieb’s bei der Schwärmerei für den Papa und bei Bongos für den vier- bzw. Schlagzeug für den sechsjährigen Filius. Es folgten Gitarre und Trompete. Verzweifelte Reaktion der Mutter: „Schon wieder ein Trumm“. Mit acht Jahren spielte Quirin Schlagzeug in Thomas Barons Big Band der Jostophers. (Baron ist inzwischen Dozent an der Hochschule für Musik und Theater München.)
Wie Niedermeiers auf die Hammondorgeln kamen
Immer wieder mal googelte Quirin, einfach so, über Hammondorgeln: deren Größe (nicht so schlimm wie befürchtet); deren Preis (hoch); und wie realistisch es wäre, sich eine Hammondorgel aus den USA über den Großen Teich transportieren zu lassen – mit Zoll, Einfuhrsteuern und Transportkosten unbezahlbar, zumal ihm eine große Konsole vorschwebte, keine kleine Heimorgel mit farbigen Tasten und Rhythmusgenerator zum Herumklimpern.
Kurz bevor alle Welt das Wort Corona fürchten lernte, stieß er plötzlich im Internet auf ein Spinett mit Tonradgenerator und Technik, ähnlich der von größeren Konsolen, wenngleich mit weniger Tasten. Ein Musiker aus Starnberg wollte den Keller frei räumen und verkaufte das alte Instrument seines Vaters. Weil es nicht mehr richtig lief und ihm der feuchte Keller nicht bekommen war, sollte es nur 300 Euro kosten. Niedermeiers waren begeistert. Mit einem Freund schafften sie das schlappe 180 kg wiegende Instrument die enge Wendeltreppe hoch und wuchteten es in den Caddy, um es in der heimischen Garage in der Frauenschuhstr. auf zwei Ytongsteinen abzustellen. Wo es noch heute steht. Damit war die Zeit des ersten Lockdowns gerettet.
 Die beiden Männer bauten sämtliche Orgelteile aus, reinigten sie von Spinnen, Käfern und Staub und vollzogen anhand von Schaltplänen aus dem Internet nach, wo daran was herumgebastelt worden war. Am Ende des ersten Lockdowns hatten sie den Originalzustand des Instruments wiederhergestellt und zwei Modifikationen hinzugefügt: einen Kopfhöreranschluss, um leise spielen zu können, sowie eine „Poor-man-fold-back“-Option, um einen tiefen Ton mit einem höheren mischen zu können, damit die tiefere Oktave satter erklingt. Die Begeisterung war groß, weil die Hammondorgel so gut funktionierte, und doch weckte sie rasch den Wunsch nach einem besseren Klangkörper. Gesagt, gegoogelt, gefunden.
Die beiden Männer bauten sämtliche Orgelteile aus, reinigten sie von Spinnen, Käfern und Staub und vollzogen anhand von Schaltplänen aus dem Internet nach, wo daran was herumgebastelt worden war. Am Ende des ersten Lockdowns hatten sie den Originalzustand des Instruments wiederhergestellt und zwei Modifikationen hinzugefügt: einen Kopfhöreranschluss, um leise spielen zu können, sowie eine „Poor-man-fold-back“-Option, um einen tiefen Ton mit einem höheren mischen zu können, damit die tiefere Oktave satter erklingt. Die Begeisterung war groß, weil die Hammondorgel so gut funktionierte, und doch weckte sie rasch den Wunsch nach einem besseren Klangkörper. Gesagt, gegoogelt, gefunden.
 In Lindlar bei Köln verkaufte ein Techniker eine C3-Hammondorgel, wie sie schon der britische Komponist und Pianist Keith Emerson und Jon Lord von Deep Purple spielten. Kein schönes Instrument. Es hatte im Blackpool Tower Ballroom in Westengland seinen Dienst getan (im Internet finden Sie ein Foto von diesem wahrhaft ikonischen Ballsaal aus dem 19. Jahrhundert samt der Hammondorgel!), weshalb aus stylischen Gründen das braune Gehäuse für alle Ewigkeit cremeweiß „angeschmiert“ worden war. Dafür hatte es mehr Tasten und Klangmöglichkeiten, ein Vollpedal und eine Leslie-Lautsprecherbox. Bei einer Leslie, so weiß Google zu berichten, erhält der Klang durch rotierende Reflektoren einen schwebenden Effekt. Kostenpunkt insgesamt: 7.000 Euro.
In Lindlar bei Köln verkaufte ein Techniker eine C3-Hammondorgel, wie sie schon der britische Komponist und Pianist Keith Emerson und Jon Lord von Deep Purple spielten. Kein schönes Instrument. Es hatte im Blackpool Tower Ballroom in Westengland seinen Dienst getan (im Internet finden Sie ein Foto von diesem wahrhaft ikonischen Ballsaal aus dem 19. Jahrhundert samt der Hammondorgel!), weshalb aus stylischen Gründen das braune Gehäuse für alle Ewigkeit cremeweiß „angeschmiert“ worden war. Dafür hatte es mehr Tasten und Klangmöglichkeiten, ein Vollpedal und eine Leslie-Lautsprecherbox. Bei einer Leslie, so weiß Google zu berichten, erhält der Klang durch rotierende Reflektoren einen schwebenden Effekt. Kostenpunkt insgesamt: 7.000 Euro.
Während des nächsten Lockdowns zerlegten Niedermeiers die C3-Hammondorgel: Sie bauten sämtliche Tasten, Tongeneration, Verstärker … aus. Damit konnten sie das sperrige Orgelgehäuse in den 1. Stock schaffen, ins gedämmte Tonstudio, wo sie die Einzelteile akribisch wieder einbauten, defekte Teile ersetzten und das Instrument in einen nahezu perfekten Originalzustand brachten.
Wie Quirin zu „my friend Q“ wurde
 Dieser Klang begeisterte Starkovich Forster, den Quirin Niedermeier in einem einschlägigen Hammondorgelforum im Internet kennengelernt hatte, bei seinem Deutschlandbesuch 2022 dermaßen, dass er meinte, Quirin müsse unbedingt in die USA kommen, um seine und viele andere Hammondorgeln zu reparieren. Was Quirin 2022 erstmals tat. Seitdem fährt er, inzwischen Lehramtsstudent für Englisch und Erdkunde, im Frühjahr und Herbst in die USA und richtet Hammondorgeln wie Leslies. Im texanischen Wichita Falls hat er sich ein Containerlager mit Ersatzteilen und einigen Verleih-Hammondorgeln eingerichtet. (O-Ton: „Das Geschäft läuft, auch wenn ich nicht vor Ort bin.“)
Dieser Klang begeisterte Starkovich Forster, den Quirin Niedermeier in einem einschlägigen Hammondorgelforum im Internet kennengelernt hatte, bei seinem Deutschlandbesuch 2022 dermaßen, dass er meinte, Quirin müsse unbedingt in die USA kommen, um seine und viele andere Hammondorgeln zu reparieren. Was Quirin 2022 erstmals tat. Seitdem fährt er, inzwischen Lehramtsstudent für Englisch und Erdkunde, im Frühjahr und Herbst in die USA und richtet Hammondorgeln wie Leslies. Im texanischen Wichita Falls hat er sich ein Containerlager mit Ersatzteilen und einigen Verleih-Hammondorgeln eingerichtet. (O-Ton: „Das Geschäft läuft, auch wenn ich nicht vor Ort bin.“)
Forster, sehr umtriebig und gut vernetzt in der nordamerikanischen Hammondorgelszene, organisiert ihm jedes Mal fast mehr Aufträge, als er in den vier Wochen abarbeiten kann. Das letzte Mal im März kam Quirin bis fast in den Bundesstaat Mississippi und schuftete am letzten Tag vor der Abreise die ganze Nacht durch, um eine unwillige Hammondorgel noch zum Laufen zu bringen. „Q’s Hammond Service. Vintage organ keys and tube AMP repair“ scheint zum Selbstläufer zu werden mit Option auf eine mögliche kreative Selbstständigkeit statt einer abgezirkelten Beamtenkarriere. Das „Q’s“ im Firmennamen übrigens deshalb, weil sich die Amis am Wort „Quirin“ die Zunge brechen würden. Für sie ist er schlicht: my friend „Q“.
Hammondorgeln sind in den USA oft in Kirchen anzutreffen
In der Neuen Welt sind die meisten Kirchen – selbst die Megachurches mit bis zu 4.500 Sitzplätzen – aus Kostengründen und auch weil ihnen die Orgelbautradition wie in Deutschland fehlt, wo selbst die kleinste Dorfkirche eine Pfeifenorgel besitzt – vielfach mit elektronischen Orgeln, Keyboards und vor allem mit Hammondorgeln ausgestattet. Der Sound von letzteren ist untrennbar verbunden mit der Black Church und eignet sich auch wunderbar zur Begleitung von Gospels.
Ihren Namen verdankt die Hammondorgel ihrem Erfinder Laurens Hammond, der nicht nur studierter Maschinenbauer, sondern auch Uhrmacher war und überhaupt ein technisch versierter „Daniel Düsentrieb“. Nach dem 1. Weltkrieg hatte er als Chefingenieur in einer Schiffsmotorenfirma gearbeitet, 1922 befasste er sich mit der Entwicklung von dreidimensionalen Kameras und drehte 3D-Filme, 1926 vertrieb er einen Wandler, der Wechselstrom zu Gleichstrom für Radios umwandelte, gefolgt von einem Electric Bridge Table, einem mechanischen Spielkartentisch … Für seine Zeitgeber erfand er um 1920 auch einen Wechselstrom-Synchronmotor, für den er, die Zeiten waren hart, das Geschäft mit Uhren und sonstigen Erfindungen schwierig, weitere Anwendungsmöglichkeiten suchte. Inspiriert von einem Mitarbeiter, der Organist einer Kirchengemeinde war, kam ihm 1933 die Idee zur Konstruktion des Tonerzeugungsprinzips der Hammondorgel, für das er 1934 das Patent erhielt. Im gleichen Jahr stellte er seine erste Hammondorgel Mod. A vor.
Niedermaiers besitzen neben diversen Hammondorgeln natürlich eine Uhr der Hammond Clock Company!