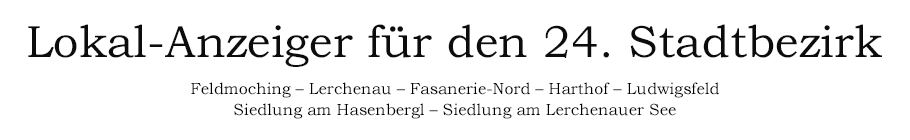Sion wie? Wenban wer? Wenn Sie diesen Maler nicht kennen, ist dies keine Bildungslücke,
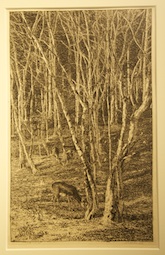
denn der Maler, der 1848 als Sohn englischer Einwanderer in Cincinati im US-Bundesstaat Ohio geboren wurde und 1878 über England und Paris nach München an die Akademie der Bildenden Künste kam, um sich künstlerisch weiterzubilden, ist relativ unbekannt. Dennoch besitzt die Staatliche Graphische Sammlung München über 100 Zeichnungen und Radierungen von ihm – allerdings ruhen sie im Depot. Und auch die Staatsgemäldesammlung hat einige Wenban-Ölbilder – auch im Depot. Die Raiffeisenbank München Nord dagegen zeigt nun in den nächsten Monaten in ihrer neuen Galerie neben der Bank an der Bezirksstr. 50 in Unterschleißheim 20 Radierungen und drei Ölgemälde des Künstlers. Aufmerksam gemacht wurden Bank und Raiffeisenbank-Stiftung auf den Künstler durch den Ortschronisten von Unterschleißheim, Wolfgang Christoph. Der war

im Rahmen seines Engagements für das Heimatmuseum Unterschleißheim auf den bis dahin weithin unbekannten Künstler gestoßen. Inzwischen hat er in Zusammenarbeit mit der Stiftung Raiffeisenbank an die 125 Exponate gesammelt, katalogisiert und einen Teil davon für die Ausstellung vorbereitet. Gezeigt werden in dieser Ausstellung vor allem Bilder mit Motiven aus Unter-/Oberschleißheim und eines von Feldmoching: „Der Feldweg mit den drei schlanken Bäumen“.
Kunst: Früher für Adelige und Bischöfe, heute für jedermann
 Kammermusikalisch umrahmt wurde die Vernissage von den Geschwistern Maria (Cello) und Matthias Well (Geige) – Jungstudenten an der Münchner Musikhochschule und dritte Generation der Musikerfamilie Well nach der Biermösl-Blosn und den Wellküren. Sie interpretierten heitere bis virtuose Stücke von nicht ganz so bekannten Komponisten wie etwa Reinhold Glière, die aber zur Zeit von Wanban ebenso passten wie zur Ausstellung – bei einer Passacaglia etwa ging man gedanklich halt keine Straße entlang (pasar una calle), sondern durch die Ausstellung.
Kammermusikalisch umrahmt wurde die Vernissage von den Geschwistern Maria (Cello) und Matthias Well (Geige) – Jungstudenten an der Münchner Musikhochschule und dritte Generation der Musikerfamilie Well nach der Biermösl-Blosn und den Wellküren. Sie interpretierten heitere bis virtuose Stücke von nicht ganz so bekannten Komponisten wie etwa Reinhold Glière, die aber zur Zeit von Wanban ebenso passten wie zur Ausstellung – bei einer Passacaglia etwa ging man gedanklich halt keine Straße entlang (pasar una calle), sondern durch die Ausstellung.  Nach einer kurzen Begrüßung der geladenen Gäste durch den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der Raiffeisenbank, Manfred Utz, sprachen die Pfarrer Johannes Streitberger (katholisch) und Thomas Lotz (evangelisch) den Segen über die neuen Räumen und zeigten sich erfreut, dass die Raiffeisenbank Kunst jedermann zugänglich mache, während diese in früheren Jahrhunderten Adeligen und Kirchenfürsten vorbehalten geblieben war. Denn Kunst bereite Freude und führe zu Gott hin.
Nach einer kurzen Begrüßung der geladenen Gäste durch den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der Raiffeisenbank, Manfred Utz, sprachen die Pfarrer Johannes Streitberger (katholisch) und Thomas Lotz (evangelisch) den Segen über die neuen Räumen und zeigten sich erfreut, dass die Raiffeisenbank Kunst jedermann zugänglich mache, während diese in früheren Jahrhunderten Adeligen und Kirchenfürsten vorbehalten geblieben war. Denn Kunst bereite Freude und führe zu Gott hin.
Wenban: Seine Leidenschaft war die Radierung
 Anschließend ordnete der Kunstexperte Andreas Strobl vom Referat für die Kunst des 19. Jahrhunderts in der Staatlichen Graphischen Sammlung München Sion Longley Wenban künstlerisch ein, rekapitulierte seine Vita und erläuterte, warum Wenban, wiewohl er eine eigene Bildersprache entwickelte, mit der er sich radikal von der damals in München gepflegten Historien- und Genremalerei mit ihren großformatigen Bildern absetzte, nur eine Randerscheinung in der Malerei des 19. Jahrhunderts blieb. Wenban (1848 – 1897) starb verhältnismäßig früh, seine Bilder sind vielfach im privaten Besitz und vor allem: Seine Bilder, insbesondere Radierungen, sind alle sehr kleinformatig, nahezu intim, die sich in Galerien nie in den Vordergrund spielten. Auch stellte Wenban keine spektakulären Sujets dar, sondern zeigte das karge, einfache Leben der Landbevölkerung. Womit er wirtschaftlich gänzlich scheiterte. Wiewohl in der Münchner Kulturszene gut vernetzt, konnte er für diese Art der Bilder keinen Markt schaffen, so Strobls Resümee.
Anschließend ordnete der Kunstexperte Andreas Strobl vom Referat für die Kunst des 19. Jahrhunderts in der Staatlichen Graphischen Sammlung München Sion Longley Wenban künstlerisch ein, rekapitulierte seine Vita und erläuterte, warum Wenban, wiewohl er eine eigene Bildersprache entwickelte, mit der er sich radikal von der damals in München gepflegten Historien- und Genremalerei mit ihren großformatigen Bildern absetzte, nur eine Randerscheinung in der Malerei des 19. Jahrhunderts blieb. Wenban (1848 – 1897) starb verhältnismäßig früh, seine Bilder sind vielfach im privaten Besitz und vor allem: Seine Bilder, insbesondere Radierungen, sind alle sehr kleinformatig, nahezu intim, die sich in Galerien nie in den Vordergrund spielten. Auch stellte Wenban keine spektakulären Sujets dar, sondern zeigte das karge, einfache Leben der Landbevölkerung. Womit er wirtschaftlich gänzlich scheiterte. Wiewohl in der Münchner Kulturszene gut vernetzt, konnte er für diese Art der Bilder keinen Markt schaffen, so Strobls Resümee.

Dabei war Wenban einer der ersten, wenn nicht der erste Künstler, der fürs Malen, angeregt durch die französischen Kollegen aus der Schule von Barbizon – diese Gruppe von Landschaftsmalern verließ erstmals die Künstlerateliers, um im Dorf Barbizon nahe Paris einen unmittelbaren Zugang zur unberührten, schlichten Natur zu gewinnen –, hinaus ins Münchner Umland ging. In seinem Fall nach Schleißheim, wo er bereits 1880 erstmals einen Sommer verbrachte. Dort fand er in einem sonst unbewohnten Teil der ausgedehnten Nebengebäude des königlichen Schlosses eine primitive Wohnung.
Die Künstlerkolonie Dachau, die sich von den Menschen dort und dem Dachauer Moos inspirieren ließ und neben Worpswede die bedeutendste Vereinigung war, bildete sich erst ein paar Jahre später heraus.
In den nächsten Monaten gibt es immer wieder Führungen
Aufgrund dieses ungewöhnlichen Schrittes hinaus vor die Stadttore erzählen Wenbans
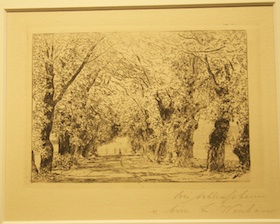
Bilder auch viel über unsere Heimat im ausgehenden 19. Jahrhundert: Sie zeigen das abgeschiedene, aber auch raue und karge Landleben, bestimmt vom Moos. Mit seinen Zeichnungen auf Metallplatte (=Radierung), die zu „seiner Kunst“ wurden, so die Einschätzung von Kunsthistoriker und Konservator Andreas Strobel, hat er „Pflügende Bauern bei Lustheim“, eine „kleine Pappelallee in Schleißheim“ oder Schleißheimer „Bauernhäuser mit entlaubten Pappeln“ festgehalten. Das imposante Schloss Oberschleißheim sucht man dagegen vergebens.
Wer sich selbst einen Eindruck von Wenbans Können verschaffen will, wende sich wegen eines Besichtigungstermins an Sarah Karbassi, Tel. 31 00 03 10 22. Sie stellt Führungen für Vereine, Schulklassen und sonstige Interessierte mit Wenban-Kenner Wolfgang Christoph zusammen.
Ein Termin steht schon fest: Am kommenden Sonntag, den 8. März erläutert Wolfgang Christoph nach der 10 Uhr Messe (also etwa gegen 11 Uhr) die Ausstellung.