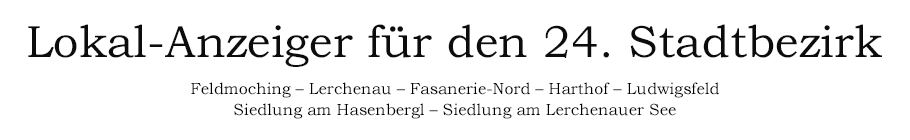Klaus Mai gelang das in Wien, im Militärhistorischen Museum. Er studierte dort eingehend das 2,20 m x 3,50 m große Schlachtengemälde „Die Schlacht bei den zwei Brücken“. Gemalt hat es Pieter Snayer (1592-1667) im Auftrag des kaiserlichen Generals Piccolomini, der beim flämischen Meister eine Reihe großflächiger Gemälde mit Schlachten aus dem Dreißigjährigen Krieg für sein Schloss bestellte.
Die Fachwelt ordnet diese Gemälde überwiegend der Kategorie der topografisch-analytischen Schlachtenbilder zu, bestimmt anno dazumal fürs Militär. Snayers Bilder geben mehr oder weniger unverfälscht die jeweilige historische Schlacht wider, bei der der Maler zwar persönlich nie anwesend war, deren militärische Formationen und Abteilungen, Truppengattungen und taktischen Verlauf er aber zeitgenössischen Schilderungen, Karten und Stichvorlagen, von Militäringenieuren angefertigt, entnahm.
 Mai hat diese Schlacht, die am 5. Oktober 1648 im Norden von München stattfand und die oft als letztes unbedeutendes Geplänkel vor Ende des 30-jährigen Kriegs zwischen der schwedischen Armee und dem kaiserlichen Heer unter der Führung von General Werth abgetan wird, auf dem Gemälde genauer studiert und in einem zweiten Schritt das Bild mit historischen Karten hinterlegt, um die Schlacht dann vor Ort genauer im Gelände verorten zu können.
Mai hat diese Schlacht, die am 5. Oktober 1648 im Norden von München stattfand und die oft als letztes unbedeutendes Geplänkel vor Ende des 30-jährigen Kriegs zwischen der schwedischen Armee und dem kaiserlichen Heer unter der Führung von General Werth abgetan wird, auf dem Gemälde genauer studiert und in einem zweiten Schritt das Bild mit historischen Karten hinterlegt, um die Schlacht dann vor Ort genauer im Gelände verorten zu können.
Mit interessanten Ergebnissen: Tatsächlich war die Schlacht größeren Ausmaßes, denn es waren daran fast 37.000 Soldaten auf beiden Seiten beteiligt. Dabei war die kaiserliche Seite für die damalige Zeit höchst modern ausgerüstet: Ihre Kavallerie, so ist auf dem Gemälde festgehalten, konnte nun vom Pferd aus mit Musketen schießen!
Außerdem hat Mai herausgefunden, dass sich der schwedische Anführer Wrangel, nachdem ihm die Kroaten „westlich der Gabelung der Würm in Krebsbach und Würm“ – dort wo heute in der Nähe der Würmkanal ist – den Weg abgeschnitten hatten, ins Moos flüchten musste, wo er natürlich seine Kanonen nicht einsetzen konnte. „Damals wurde das Gebiet auch als Sommerweide bezeichnet. Heute befindet sich dort das Schwarzhölzl und die Schwarzhölzlsiedlung“, ist auf der Tafel zum Dreißigjährigen Krieg zu lesen. Und man kann dort vor allem die älteste bekannte Darstellung des Dorfs Feldmoching um 1648 bewundern!
Sehr interessant sind ferner die Tafeln zur Fliegertechnischen Schule in Oberschleißheim, deren Lehrgangsteilnehmer in Baracken am südlichen Ende des Flugplatzes untergebracht wurden. Später wurde daraus das Lager Frauenholz.
Und natürlich fehlen auch die Tafeln zu den keltischen, römischen und bajuwarischen Spuren auf dem Gfild ebenso wenig wie die Tafeln zu den Feldmochinger Mühlen, dem kurfürstlichen Kanalsystem, zur „Feldmochinger“ Tracht, zum Zehentmayerhof…
Die nächste Führung durch Ausstellungsmacher Mai findet am 13. März ab 18 Uhr statt. Sie ist kostenlos und unbedingt empfehlenswert!