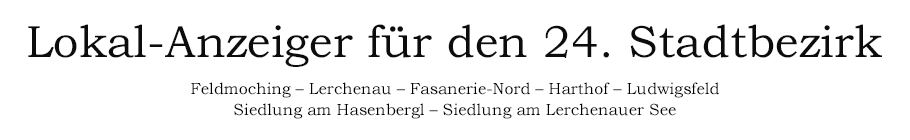Die ehemalige Gemeinschaftspraxis Dechamps / Dr. Fuhrmann / Dr. Oster an der Ittlingerstr. wird seit einem Jahr von nur zwei jungen Medizinern weitergeführt – wovon eine seit Monaten krank ist. Die Folge: Selbst bei akuten Erkrankungen muss man tagelang auf einen Termin warten, neue Patienten werden abgelehnt.
Dr. Prause, der an der Schleißheimer Str. 427 jahrzehntelang eine florierende Frauenarztpraxis unterhielt, fand keinen Nachfolger. Und die Kinderärztin Dr. Gobmeier sowie die Internisten Dr. Moosauer / Dr. Dr. Döschl am Frühlingsanger mussten lange suchen, bis sie Nachfolger fanden. Aber: Der eine „Neue“ achtet auf seine „Work-Life-Balance“ und bietet weniger Sprechzeiten an, während die Moosauer-Nachfolger schon bald das Hasenbergl gen Nordhaide verließen, um auch dort schnell das Handtuch zu werfen und auszuwandern. Am Feldmochinger Anger praktizierte früher der Allgemeinarzt Dr. Steudemann – ein Arzt folgte ihm nicht nach. Und auch in Feldmoching darf man schon heute den Tag fürchten, wenn die beiden Allgemeinmediziner des Orts, inzwischen auch im fortgeschritteneren Alter, ihre Praxen aufgeben.
Ein „Fachforum“ zur Ärzteversorgung am Hasenbergl
Aufgeschreckt durch diese Entwicklung wandten sich im September 2013 der CSU-

Landtagsabgeordnete Joachim Unterländer und CSU-Bezirksrat Rainer Großmann mit einem Schreiben an den Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB), Wolfgang Krombholz, und wiesen auf den drohenden medizinischen Versorgungsmangel im Münchner Norden hin. Am Mittwoch, den 22. Januar fand im Veranstaltungssaal des Kulturzentrums 2411 ein „Fachforum Ärzte- und Pflegeversorgung am Hasenbergl“ statt. Teilnehmer: Pflegekräfte, die im Münchner Norden tätig sind, Apotheker und niedergelassene Ärzte wie Dr. Christa Scholtissek (Stösserstr. 14), Karl Ernst Banhardt (Waldmeisterstr. 72) und Dr. Andreas Trieb (Knorrstr. 16) sowie der Direktor der AOK München, Robert Schurer. Der KVB-Vertreter war dagegen „zeitlich verhindert“. Krombholz hatte in einem Gespräch mit Unterländer aber bereits deutlich gemacht, dass es keinen Versorgungsmangel in München gebe: 1.400 Allgemeinmediziner machten einen Versorgungsgrad von 123 %. Es bedürfe daher keiner neuen Bedarfsplanung, so berichtete Unterländer vom Gespräch. Und überhaupt habe die KVB keinen Einfluss darauf, wo sich Ärzte niederlassen wollten.
Die ärztliche Versorgung zählt zur kommunalen Daseinsvorsorge
AOK-Direktor Schurer erläuterte den Anwesenden, wie Münchens Versorgungsgrad von 123 % zustande kommt: Gemäß der Arzt-/Einwohnerrelation von einem Allgemeinmediziner auf 1.671 Bewohner habe man nach den gesetzlichen Bestimmungen eben eine Überversorgung. Wenngleich seit 2010 bekannt ist, so Schurer, dass es im Münchner Norden und Osten eine ärztliche Unterversorgung gibt. Doch man könne niederlassungswillige junge Ärzte nicht einfach dorthin schicken, schließlich gibt es eine Niederlassungsfreiheit. Dass fertige Ärzte am liebsten in die Stadtmitte gehen, wo das Hausarztprinzip inzwischen verwirklicht sei, so Schurer ironisch – in jedem Haus ein Arzt –, ist der „Generierung von Einnahmen“ geschuldet. In der Stadtmitte sind viele Leute und damit viele Patienten, vor allem aber Privatpatienten. In Stadtrandlagen dagegen wohnen, so Schurer, wie auf dem Land weniger Privatpatienten, dafür aber mehr ältere Patienten, die einen höheren Betreuungsaufwand bedeuteten.
zustande kommt: Gemäß der Arzt-/Einwohnerrelation von einem Allgemeinmediziner auf 1.671 Bewohner habe man nach den gesetzlichen Bestimmungen eben eine Überversorgung. Wenngleich seit 2010 bekannt ist, so Schurer, dass es im Münchner Norden und Osten eine ärztliche Unterversorgung gibt. Doch man könne niederlassungswillige junge Ärzte nicht einfach dorthin schicken, schließlich gibt es eine Niederlassungsfreiheit. Dass fertige Ärzte am liebsten in die Stadtmitte gehen, wo das Hausarztprinzip inzwischen verwirklicht sei, so Schurer ironisch – in jedem Haus ein Arzt –, ist der „Generierung von Einnahmen“ geschuldet. In der Stadtmitte sind viele Leute und damit viele Patienten, vor allem aber Privatpatienten. In Stadtrandlagen dagegen wohnen, so Schurer, wie auf dem Land weniger Privatpatienten, dafür aber mehr ältere Patienten, die einen höheren Betreuungsaufwand bedeuteten.
 Was also tun, um mehr Mediziner in den Norden zu locken, wo im Vergleich zum Münchner Süden oder gar Starnberg wenige Privatpatienten sind? AOK-Direktor Schurer empfahl den Anwesenden, dass sich der Münchner Norden wie die Dörfer auf dem Land „aufhübschen“ und „attraktiver machen“ müsste. Er denkt dabei an eine Unterstützung bei Praxisräumen oder in Form von attraktivem Baurecht. Auch könne man bei der Niederlassungsberatung der KVB – dort suchen niederlassungswillige Ärzte Rat – für sich werben, um etwa Vorurteile gegen den Münchner Norden abzubauen. So wie die Kommune für Kindergärten aufkomme, müsse sie eben auch ein Gesundheitsmanagement betreiben, riet Schurer. Ärzteversorgung müsse der Kommunalpolitik eine Verpflichtung sein.
Was also tun, um mehr Mediziner in den Norden zu locken, wo im Vergleich zum Münchner Süden oder gar Starnberg wenige Privatpatienten sind? AOK-Direktor Schurer empfahl den Anwesenden, dass sich der Münchner Norden wie die Dörfer auf dem Land „aufhübschen“ und „attraktiver machen“ müsste. Er denkt dabei an eine Unterstützung bei Praxisräumen oder in Form von attraktivem Baurecht. Auch könne man bei der Niederlassungsberatung der KVB – dort suchen niederlassungswillige Ärzte Rat – für sich werben, um etwa Vorurteile gegen den Münchner Norden abzubauen. So wie die Kommune für Kindergärten aufkomme, müsse sie eben auch ein Gesundheitsmanagement betreiben, riet Schurer. Ärzteversorgung müsse der Kommunalpolitik eine Verpflichtung sein.
Weniger Bürokratie, mehr Hilfe beim Formularkrieg
 Auch die anwesenden Ärzte hatten einige Verbesserungsvorschläge, wie die Ärztegewinnung künftig besser klappen könnte. Sie machten aber vor allem das „System“ und die zahllosen Reformen, mit denen das Gesundheitssystem seit den Tagen von Norbert Blüm und Helmut Kohl auf Wirtschaftlichkeit getrimmt wird, für die Misere und den zunehmenden Ärztemangel verantwortlich. Die ausufernde Dokumentation, die ein Arzt, aber auch eine Pflegekraft leisten müsse, „törne ab“. Kein junger Arzt wolle heute mehr wie ein „Treppenterrier“ abends noch Hausbesuche machen, die wollten wie seine eigenen Kinder mehr „chillen“, meinte etwa Dr. Banhardt. Hausbesuche und die „sprechende Medizin“ überhaupt müssten wieder besser vergütet werden, war eine andere Forderung. Schließlich müsse ein junger Arzt ja erst einmal viel investieren.
Auch die anwesenden Ärzte hatten einige Verbesserungsvorschläge, wie die Ärztegewinnung künftig besser klappen könnte. Sie machten aber vor allem das „System“ und die zahllosen Reformen, mit denen das Gesundheitssystem seit den Tagen von Norbert Blüm und Helmut Kohl auf Wirtschaftlichkeit getrimmt wird, für die Misere und den zunehmenden Ärztemangel verantwortlich. Die ausufernde Dokumentation, die ein Arzt, aber auch eine Pflegekraft leisten müsse, „törne ab“. Kein junger Arzt wolle heute mehr wie ein „Treppenterrier“ abends noch Hausbesuche machen, die wollten wie seine eigenen Kinder mehr „chillen“, meinte etwa Dr. Banhardt. Hausbesuche und die „sprechende Medizin“ überhaupt müssten wieder besser vergütet werden, war eine andere Forderung. Schließlich müsse ein junger Arzt ja erst einmal viel investieren.
Christa Scholtissek, die in ihrer Praxis im Hasenbergl Nord viele Hartz-IV-Patienten und

„strukturelle Analphabeten“ (diese können Buchstaben und Worte zwar erkennen, erfassen deren Sinn aber nur mit Mühe) hat, schlug eine vernetztere Arbeitsweise zwischen Ärzten und Sozialdiensten vor. Ihre Patienten seien beispielsweise oft nicht in der Lage, die Formulare für eine Kur auszufüllen oder einen Ablehnungsbescheid zu verstehen. Auch für einen Asylanten einen Krankenschein zu bekommen, sei eine aufwendige Geschichte, die ebenfalls am Arzt hängen bleibe.
Blodigstr.: Warum kein Ärztehaus wie einst angedacht?
Eine andere Teilnehmerin des Forums erinnerte daran, dass im Zuge des Neubaus des Einkaufs- und Kulturzentrums an der Blodigstr. Bauherr und Immobilienbesitzer Doblinger eigentlich auch ein Ärztezentrum auf dem Areal geplant hatte. Sie wollte wissen, ob hierfür eigentlich die Genehmigung versagt worden sei. Auch AOK-Chef Schurer erläuterte, dass der Trend unverkennbar hin zu Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) ginge, da jüngere Menschen eher dieses medizinische Angebot wollten, weil der Weg zwischen den verschiedenen Medizinsparten gering sei. Unterländer versprach, sich darum zu kümmern, was aus den Plänen geworden sei.
Mehr Wertschätzung und Geld für die Pflegekräfte
Derzeit gibt es in Deutschland etwa 2,5 Millionen pflegebedürftige Menschen. Ihre Zahl soll schon 2030 auf 3,4 Millionen hochschnellen. Angesichts dieser Zahlen wird die Frage „Was ist uns die Pflege wert?“ zentral werden. Da wegen der schlechten Bezahlung und der noch schlechteren Arbeitsbedingungen – Stichwort: „durchgetaktete Pflege“ – der Pflegeberuf unter jungen Leuten in Deutschland unattraktiv ist – in anderen Ländern ist dafür sogar ein Studium zu absolvieren! – wird Deutschland noch mehr Fachkräfte im Ausland anwerben müssen. Doch die Politik erschafft vor allem wieder einmal neue Strukturen und will in Bayern analog zur Ärztekammer eine Pflegekammer installieren. Mehr Pflegekräfte wird aber auch die nicht herzaubern können.
Ikarus, ein freiwilliger Zusammenschluss von VertreterInnen verschiedener Berufsgruppen und Institutionen im Münchner Norden und in Schwabing, hat deshalb einen offenen Brief zum Thema „Pflege und häusliche Versorgung im Münchner Norden“ verfasst. Denn: Mag sich die Pflegesituation generell ob des Pflegekräftemangels verschlechtert haben, so ist sie im Münchner Norden noch dramatischer, weil es hier zum einen viele Menschen mit Migrationshintergrund und damit Sprachproblemen, zum anderen viele ältere Menschen gibt, die knapp über der Schwelle zur Grundsicherung sind und weder häusliche Versorgung noch Pflege selbst finanzieren können. Auch fehlen im Münchner Norden Fachärzte im geriatrischen Bereich, vor allem Psychiater, Neurologen, Orthopäden und Urologen, aber auch Hausärzte, die ihrem Namen noch Ehre machen und für alte, immobile Patienten Hausbesuche anbieten.
Laut Dr. Trieb, dem es vor allem ein Anliegen ist, Patienten in ihrer häuslichen Umgebung zu therapieren, um eine Kurz- oder gar Langzeitpflege in einem Heim möglichst zu verhindern, liegt ein gemeinsamer Nenner für viele Probleme in der Pflege im Missverhältnis zwischen direkter Arbeit am Patienten und dem Zeitaufwand für die aufwendige Dokumentation (z. B. Wund-Doku, Beratungs-Doku, Foto-Doku, Blutzucker- und Blutdruck-Doku…). So würden oft erfahrene Fachkräfte nur noch in den Stützpunkten bleiben und dokumentieren. Andererseits könnten auch Nicht-Fachpflegekräfte eigentlich viele Arbeiten erledigen, wie Essen einflössen, doch Pflegedienste und Heime müssten zwangsweise eine Quote von 50 % Fachkräfte haben.