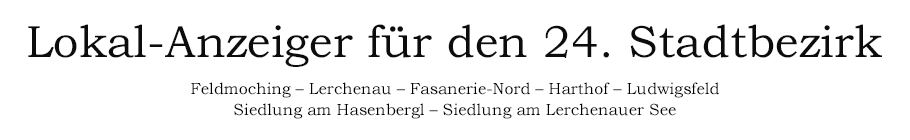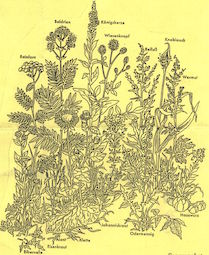Wie auf der letzten öffentlichen Sitzung des Bezirksausschusses 24 am 27. Juli zu erfahren war, wird die Buche an der Ebereschenstr. 55, die einem Bauvorhaben im Wege steht, von der Unteren Naturschutzbehörde nun direkt vor Ort auf ihre Vitalität überprüft. Offensichtlich hatten die Experten, so BA-Vorsitzender Markus Auerbach, via Google Earth zahlreiche Verkahlungen bei dem Baum ausgemacht. Sei er nicht kerngesund, so BA-Chef Auerbach, sei sein Schicksal wohl besiegelt. Denn einem privaten Bauherrn könne nicht zugemutet werden, erläuterte die Vorsitzende des Unterausschusses Planung, Verkehr & Umwelt, Gabi Meissner, beim Bau für eine Wurzelschutzmaßnahme zu sorgen. Das sei zu teuer.
Mehr Nachmittagsbetreuung in der Siedlung Ludwigsfeld
Auch in der Siedlung Ludwigsfeld stehen 12 Kinder, die in die Verbandsgrundschule nach Karlsfeld gehen, noch ohne nachmittägliche Betreuung da. Hier zeichnet sich allerdings eine Lösung ab: Im Mehrgenerationenhaus, in dem auch das Jump-in untergebracht ist, sind zwei Räume frei, weil nicht mehr so viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Deutschland strömen. Die Caritas möchte dort nun eine sogenannte Großtagespflege einrichten, bei der mindestens fünf Plätze zu Beginn des neuen Schuljahrs für ABC-Schützen zur Verfügung stehen sollen. Der hiesige Bezirksausschuss richtete an die Landeshauptstadt die Anträge, a) dafür zu sorgen, dass zu Beginn des neuen Schuljahres gleich zehn Plätze für Schulkinder zur Verfügung stehen und b) dass die Stadt für Ludwigsfelder Kinder der Verbandsgrundschule, die dort weder in den Hort noch eine Nachmittagsbetreuung unterkommen, die Differenz der Hortkosten übernimmt, die zwischen Karlsfelder und städtischen Münchner Horten bestehen.
Aufgrund der Randlage der Siedlung Ludwigsfeld ist das Angebot der Stadt München, dort nicht versorgte Kinder täglich in einen Sammelhort in den Münchner Süden zu fahren, eher theoretischer Natur und für die Eltern inakzeptabel. Die Stadt solle vielmehr dafür sorgen, dass in der Siedlung Betreuungsplätze aufgebaut beziehungsweise in Karlsfeld auf freie Hortkapazitäten zugegriffen werden könne, so der BA.
Umleitung der Güterzüge raubt Anwohnern den Schlaf
Ein Güterzug donnert über das Gleis entlang der Berberitzenstr. in der Lerchenau und in Feldmoching. Bereits sieben Minuten später kommt der nächste. Seit 8. August ist die Ruhe entlang der Bahntrasse empfindlich gestört, das Zugaufkommen hat sich von einem Tag auf den nächsten verdoppelt.
„Der Zustand ist unerträglich“, so Anwohnerin Stefanie Bartle, gleichzeitig Vorsitzende des Aktionskreis contra Bahnlärm München Nord (A.c.B.), der sich bereits seit Monaten für einen Schutz der Anlieger vor steigendem Güterzuglärm einsetzt. „Ich habe in einer Stunde zwischen 23 und 0 Uhr acht Züge gezählt. Und das, obwohl das Gleis ohne jeglichen Lärmschutz wenige Meter an Wohnhäusern vorbeiführt. An eine erholsame Nachtruhe ist derzeit nicht zu denken“, so Bartle. „Ich verstehe nicht, warum an den Großbaustellen entlang der Hauptverkehrsstraßen in München nachts aufgrund des Lärms nicht gearbeitet werden darf, die Anwohner eines Gütergleises aber überhaupt keinen Anspruch auf nächtlichen Lärmschutz haben.“
Der Leiter Fahrplan bei der DB Netz Region Süd, Dietmar Karg, erklärt auf telefonische Anfrage, dass aufgrund einer Baustelle zwischen Regensburg und Nürnberg der Güterverkehr bis zum 12. September großräumig umgeleitet werde und deshalb die Strecke durch den Münchner Norden zeitlich befristet erheblich mehr befahren sei.
Die betroffenen Anwohner müssen also „nur“ fünf Wochen Schlafmangel in Kauf nehmen. Der A.c.B. gibt allerdings zu Bedenken: „Wenn das ein Vorgeschmack darauf ist, was uns nach Inbetriebnahme der Feldmochinger Kurve droht, ist das für die Anwohner auf Dauer gesundheitsschädlich.“
Sinkende Flüchtlingszahlen, geänderte Planungen
Nachdem die Flüchtlingszahlen in den letzten Monaten doch stark rückläufig sind, wird die geplante große Flüchtlingsunterkunft an der Karlsfelder Str. 282 in der Siedlung Ludwigsfeld nicht weiter verfolgt, wie auf der letzten Sitzung des Bezirksausschusses 24 zu hören war. Und die bereits gebaute Unterkunft am Tollkirschenweg wird nun nicht als Erstaufnahmestelle für minderjährige Flüchtlinge gebraucht, sondern zu deren „stationäre Betreuung“ wie im Alveni-Haus am Blütenanger verwendet.
Infrastruktur in der Siedlung am Lerchenauer See verbessern
Anfang Juli besuchten einige Mitglieder des Sozialausschusses gemeinsam mit Vertretern des Bezirksausschusses und Regsam die Siedlung am Lerchenauer See. Sie machten sich selbst ein Bild von der örtlichen Jugendfreizeitstätte sowie der Schulinfrastruktur und konnten im Gespräch weitere Eindrücke sammeln.
SPD- und CSU-Fraktion forderten daraufhin dieser Tage die Verwaltung in einem gemeinsamen Antrag auf, die Infrastruktur in der Siedlung zu überprüfen und Verbesserungspotenzial darzustellen. Konkret soll die bauliche Situation der Jugendfreizeitstätte mit dem Ziel der baulichen Trennung zur Hausmeisterwohnung sowie einer Erweiterung unter die Lupe genommen werden. Außerdem soll die Grund- und Mittelschule sowie die Kita gemäß den aktuellen Bedarfen überplant und dabei insbesondere auf die Ganztagsbetreuung für Schüler geachtet werden. Darüber hinaus soll auch eine mögliche Eröffnung eines Nachbarschaftstreffs geprüft sowie geeignete Angebote für Senioren realisiert werden. Dazu Christian Müller, sozialpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion: „Regsam hat in den letzten beiden Jahren gemeinsam mit vielen Akteuren die Siedlung am Lerchenauer See verstärkt untersucht und bereits wertvolle Netzwerkarbeit geleistet. Wir haben uns nun selbst ein Bild machen können und danken den vielen engagierten Kräften vor Ort. Wir wollen die Arbeit noch weiter unterstützen und passgenaue Angebote ermöglichen. In der Siedlung wohnen überdurchschnittlich viele alleinerziehende Familien sowie ältere Menschen. Insofern sind Verbesserungen der Ganztagsbetreuung, der Angebote in der Jugendfreizeitstätte und für die Senioren wichtig.“ Und Marian Offman, sozialpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion, ergänzt: „Die Bewohnerinnen und Bewohner der Lerchenau haben sich in den letzten beiden Jahren viele Gedanken um die soziale Gestaltung ihres Viertels gemacht. Der Freizeittreff Lerchenauer des Kreisjugendrings muss beispielsweise ertüchtigt werden, um den Jugendlichen eine attraktive Anlaufstelle bieten zu können. Im Zuge dieser Maßnahme könnte auch ein Nachbarschaftstreff etabliert werden, damit dort ein vollwertiger Viertel-Mittelpunkt entsteht. Wir möchten die Anwohnerinnen und Anwohner in ihrem Engagement bestärken, zumal es durchaus weiteres Aufwertungspotential in der Gegend gibt.“
P.S.: Die Politiker aus der Stadt sollten bei den „Bedarfen“ auch das Schwimmbad der Toni-Pfülf-Mittelschule nicht vergessen, das seit Jahren der Sanierung harrt – das wurde schließlich früher von mehreren Schulen im Umkreis genutzt! Auch die Einkaufssituation stellt sich in der Siedlung trotz des iranischen Einkaufsmarkts für die hiesige ältere Bevölkerung nach wie vor schlecht dar.
24. Stadtbezirk: Eigene Einwohnermeldestelle gewünscht
Der 24. Stadtbezirk wächst und wird durch die zahlreichen großen Bauvorhaben in den nächsten Jahren noch einmal gewaltig zulegen. Die CSU-Fraktion im hiesigen Bezirksausschuss beantragte deshalb in der letzten öffentlichen Sitzung des Gremiums vor der Sommerpause, dass der nördliche Stadtbezirk im Zuge der Neuorganisation der Münchner Bürgerbüros eine eigene Einwohnermeldestelle mit Zulassungsstelle, einem dazugehörenden Schilderdienst und einer eigenen Bezirksinspektion erhält. (Wer etwa einen neuen Pass beantragt, der weiß, wie lange man dafür heute anstellen darf!!) Laut BA-Vorsitzendem Markus Auerbach ist derzeit ein Standort in Moosach angedacht, denn die Münchner sollten nicht länger als eine halbe Stunde Fahrzeit zum nächsten Bürgerbüro haben. (Was aber gar nicht das Problem ist, sondern die Wartezeit dort! Wie heißt es doch seit Monaten so schön im Internet: „Wegen Personalausfällen, IT-Problemen und des großen Kundenandrangs kommt es in einigen Bereichen zu stundenlangen Wartezeiten“. Ja, so ist es. Fürwahr.) Der BA befürwortete den Antrag, da ein Standort im Bezirk „wohltuende Wirkung“ haben können (O-Ton Auerbach).
Kampf den Krähen und Elstern: Abfallbehälter mit Dach gewünscht
Raben und Krähen sind clever und wissen, dass Abfalleimer für sie leckere Dinge enthalten. Daher kann man immer wieder beobachten, wie sie am Rand eines Abfalleimers sitzen und die von Menschen weggeworfenen Dinge aus dem Mülleimer herauspicken und im Umkreis verteilen. Bündnis 90 / Die Grünen beantragten deshalb auf der letzten öffentlichen Sitzung des hiesigen Bezirksausschusses vor der Sommerpause, dass die am Lerchenauer See aufgestellten Abfallbehälter durch Modelle mit Dach ersetzt werden. Dieser Idee schloss sich gleich Bernd Hechenblaikner von der SPD an, der auch für den Grünzug zwischen Kleingartenanlage an der Grohmannstr. und dem Krautgarten im nördlichen Hasenbergl solche Abfallbehälter wünscht. Dort durchsucht das Krähenvolk nämlich auch gerne die Abfalleimer und schmeißt alles auf den Boden, auf dass der herumliegende Unrat in der Folge Ratten angezogen hat.
Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs rückt näher
Die schon lange antiquierte Beschrankung des Bahnübergangs in der Fasanerie ist seit Jahrzehnten nicht etwa nur ein Ärgernis für die am stärksten betroffene Fasanerie, sondern auch für die Bewohner im gesamten nördlichen Stadtgebiet sowie für unzählige Berufspendler in der Früh und am Nachmittag. Nun endlich keimt die Hoffnung auf, dass die unterschiedlichsten Behörden und Dienststellen bei der Landeshauptstadt und der Deutschen Bahn, die am Projekt beteiligt sind, doch noch zueinander gefunden und sich auf ein gemeinsames Realisierungskonzept verständigt haben, um die Höhengleichheit von Feldmochinger Str. und Bahntrassen zu beseitigen.
Die Einladung der betroffenen Bürger in der Fasanerie zu einem Bürgerworkshop am Mittwoch, den 23. Juli in der Mehrzweckhalle an der Georg-Zech-Allee durch das Baureferat, Projektmanagement Tiefbau, der Landesshauptstadt München enttäuschte sehr schnell einen Großteil der bisher aktiven Bürgersprecher, als der Grund des Workshops richtig erkannt geworden war. In der Einladung hieß es nämlich, es solle im Dialog mit den Bürgerinnnen und Bürgern frühzeitig (!) die Gestaltung des Platzes (wo heute die Feldmochinger Str. über die Gleise führt) abgestimmt werden. Aha! Es ging also gar nicht mehr um die Mitgestaltung der Art der Bahnunterführung beziehungsweise um die Beratung damit zusammenhängender Fragen, die viele Menschen immer noch bedrücken, sondern lediglich um die Ausgestaltung des kleinen, künftig frei werdenden Platzes.
Zugrunde liegt der Beschluss des Stadtrats
Zur Einführung des Abends verwies Robert Adam von der Verkehrsplanung im Baureferat auf den Beschluss des Münchner Stadtrats nach dem vorliegenden Verkehrskonzept für den Münchner Norden vom 22. Oktober 2014, der die Höhenfreimachung in der Fasanerie zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Fasanerie als dringend notwendig feststellte. Nach den nun „fixen“ Plänen wird der beschrankte Bahnübergang Fasanerie an der Feldmochinger Str. durch eine rund 300 m weiter südlich neu entstehende Unterführung ersetzt werden. Für der Fuß- und Radverkehr wird hingegen am Ort des heutigen Bahnübergangs eine separate Unterführung gebaut, welche auch die Bahnsteige der S-Bahn erschießt.
Die zuvor an einem Runden Tisch mit den beteiligten Parteien seitens der BürgerInnen der Fasanerie am höchsten favorisierte Tieferlegung der gesamten Bahntrasse (die sogenannte Troglösung) im Streckenbereich der Fasanerie ist demnach längst vom Tisch und abgehakt.
A99-Anbindung und Unterführung sollen Mehrverkehr abwickeln
Die so geplante Höhenfreimachung, erläuterte Verkehrsplaner Adam weiter, werde, gepaart mit der Verlängerung und dem Anschluss der (teiluntertunnelten) Schleißheimer Str. (siehe aber Bericht im Lokal-Anzeiger 15/2016) an die A 99 den zu erwartenden weiteren Anstieg des Verkehrsaufkommens (allein BMW mit seinen Neubauplänen und den vielen Zulieferbetrieben wird für einen Anstieg in den kommenden Jahren um bis zu 30.0000 Arbeitsplätze im Münchner Norden sorgen) ausreichende Kapazitäten schaffen. Dieser Auffassung wollten sich jedoch einige Bürger der Fasanerie nicht anschließen.
Bürger wünschen Höhenfreimachung im Dreierpack
Die Höhenfreimachung der Bahnübergänge im engeren Raum sollten zeitnah im „Dreierpack“ angegangen werden, so lauteten einige Vorschläge beziehungsweise Forderungen. Es sollten also nach dem Bahnübergang an der Feldmochinger Str. in der Fasanerie möglichst bald auch die jetzt noch höhengleichen Bahnübergänge an der Lerchenauer Str. und an der Lerchenstr. folgen, auf dass auch diese beiden Straßen einen Teil des Verkehrsaufkommens „abbekommen“. Die Fasanerie könnte nämlich, so befürchten manche, auch oder gerade mit der neuen Unterführung viel mehr Autoverkehr anziehen, auf dass sie daran „ersticke“.
Moosglöckchenweg soll Verkehr aus der südlichen Fasanerie aufnehmen
Die Vorgabe für die nun vorliegenden Planungen war und ist, Eingriffe in Privatgrund und in vorhandene Biotope möglichst gering zu halten, so Peter Schösser vom Management Tiefbau. Dies geschehe in enger Kooperation zwischen der Deutschen Bahn und der Landeshauptstadt. Eine 2 bis 4 m hohe Schallschutzwand auf Höhe des Tollkirschenwegs und der Trollblumenstr. werde den Lärm von der neuen Straßentrasse in Richtung Unterführung und zugleich vom Bahnkörper zum nördlich anschließenden Siedlungsbereich in Richtung Moosglöckchenweg wirksam abschirmen, so sein Einschätzung. Eine derartige Wand wird allerdings in der Siedlung gewöhnungsbedürftig sein, wie es einige Einwände erkennen ließen. Ob auch zur Südseite hin eine Schallschutzwand errichtet werden soll, müsse noch genauer geprüft werden, erklärten die zuständigen Planer
Der Moosglöckchenweg soll auf der Strecke westlich des Tollkirschenwegs bis zur Einmündung in die Feldmochinger Str. in etwa auf der Höhe des jetzigen Kriegerdenkmals ausgebaut werden. Diese Straße muss dann den Verkehr eines Teils der südlich gelegenen Siedlung, so auch den der Trollblumenstr., zur Feldmochinger Str. hin aufnehmen. Unverständlich ist, dass diese wichtige Einmündung nicht mit einer Verkehrsampel ausgestattet werden soll. Nach Ansicht Schössers reicht hier eine Fußgängerquerungsinsel aus, damit auch Kinder, Senioren und Radler sicher die andere Straßenseite – und damit die S-Bahn – erreichen.
Die neue Trasse der Feldmochinger Straße mündet nach der Unterführung, südlich der Höhe Trollblumenstr., nach rund 150 bis 200 m in die alte Feldmochinger Str. in Richtung zur Max-Born-Str. ein. Hier ist eine Verkehrsampel vorgesehen, damit eine beiderseitige Ein- und Ausfahrt in den östlich verlaufenden Teil der alten Feldmochinger Str., unter anderem hin zur Himmelsschlüsselstr., möglich ist.
Ein neues Ortszentrum für die Fasanerie am Bahnhof
Die Einsicht der Veranstalter, man könne wohl doch nicht die Diskussionen über die bereits feststehende Verkehrsführung und über die künftige Gestaltung der im Bereich des jetzigen Bahnübergangs bis hin zum Standort des Kriegerdenkmals vorgesehenen frei werdenden Fläche voneinander trennen, hatte die amtlich vorgesehene Workshop-Reihenfolge zeitlich verdreht. Denn nun kam das ursprüngliche Hauptthema des Abends, die „Platzgestaltung“, erst am Ende der Vorträge zur Sprache.
Ob die BürgerInnen der Fasanerie nun die Erwartung des Landschaftsarchitekten Peter Kühn teilen werden, die Gestaltung der frei werdenden Fläche solle letztlich zu einem neuen Zentrum in der Fasanerie führen, wird sich vermutlich erst nach den endgültigen Resultaten entscheiden. Die Firma Burger Landschaftsarchitekten, Susanne Burger und Peter Kühn, ist jedenfalls damit beauftragt, den neuen Platz am Bahnhof unter Einbeziehung einer modernen und großzügigen Unterführung für Fußgänger und Radfahrer und der barrierefreien Anbindung an die zwei Bahnsteige zu einem attraktiven Treff- und Ruhepunkt für Menschen zu gestalten. Eine nicht ganz einfache Aufgabe, zu der die Planer nun gute Ideen der Bürger einsammeln und diskutieren wollten. BA-24-Vorsitzender Markus Auerbach meldete sich dazu mit der Aufforderung an die Runde zu Wort, die kreativen Vorstellungen und Wünsche zur künftigen Platzgestaltung nicht etwa nur auf den kleinen Raum unmittelbar am Bahnhof zu begrenzen, sondern nun die vielleicht einmalige Chance wahrzunehmen, auch die noch vorhandenen kleineren Freiflächen im Stadtbesitz im näheren Bahnhofsumkreis in die vorgesehene Gestaltung mit einzubeziehen. Ein sehr guter Vorschlag.
Die Rampen sind das Problem, eröffnen aber auch Möglichkeiten
Das technische Hauptproblem, so war an diesem Abend zu erfahren, sind die Rampen zum Tunnel auf beiden Seiten, weil sie in gerader Ausführung zu lang würden. Die Lösung liegt im Bau von runden Rampenanlagen und zwar in einer offenen Baugestaltung. Allerdings ginge damit ein beträchtlicher Teil des freien Platzes schon wieder verloren. Auch das Kriegerdenkmal des Heimat- und Kameradschaftsvereins Fasanerie-Nord wird an seinem jetzigem Standort – das Areal, worauf es steht, ist in Privatbesitz – nicht verbleiben können. (Näheres dazu in einem separaten Beitrag.)
In den Workshops und den anschließenden Diskussionen kam dann die Idee auf, die Absenkung nicht etwa nur für den Tunnel vorzusehen. Man könne auch daran denken, den Tunnel mit einer größeren abgesenkten Freifläche nach Art eines Atriums (gern mit einem Brunnen und mit Bepflanzung) zu verbinden, wo sich die Menschen zum Ausruhen aufhalten oder sich treffen könnten, um Ball zu spielen oder sonst einer gemeinsamen Aktivität nachzugehen. Dies käme dann schon der Idee eines Zentrums näher.
Ein zweiter Workshop folgt am 22. September
Das Baureferat beabsichtigt, nach den Ferien, genauer gesagt am Donnerstag, den 22. September, einen zweiten Workshop zu diesen Themen folgen zu lassen.
Bis dahin will das Referat die vielen Fragen und Anregungen aus der Veranstaltung bearbeiten. Einige gravierende Fragen und Probleme müssen dann befriedigend beantwortet werden: etwa die gesamte Verkehrssicherheit entlang der Feldmochinger Str., insbesondere die Fragen der Querungen und der Zuwegungen zum Bahnhof sowie zum erwarteten Parkproblem – denn trotz weiter steigender PKW-Zahlen ist kein P&R-Parkplatz in der Fasanerie vorgesehen. Beantwortet werden müssen auch Fragen nach der Entschädigung für private Flächen und eventueller Wertverluste. Auch die problemlose Zufahrt zum Edeka-Markt konnte noch nicht befriedigend beantwortet werden. Schließlich sorgen sich die Anwohner der Himmelsschlüsselstr., dass künftig wieder mehr Autofahrer hier eine für sie vorteilhafte Ausweichmöglichkeit erkennen könnten.
Und wie sieht die Zeitschiene aus?
Einen genauen Terminplan konnte Baumanager Schösser nicht vorgeben. Nach den Bürgerworkshops werde der Stadtrat zu einem Abschluss der Vorplanungen kommen. Erst danach werden die Planfeststellungsunterlagen bei den zuständigen Behörden eingereicht. Nach deren gründlicher Prüfung ergeht der Planfeststellungsbeschluss. Und nach dem abschließenden Stadtratsbeschluss könnten dann irgendwann ab 2020 die Bagger anrollen. Bei den zu erwartenden Einsprüchen, den juristischen Auseinandersetzungen und den vorgeschriebenen Ausschreibungen könnte „irgendwann ab 2020“ auch einige Jahre später bedeuten.
Mariä Himmelfahrt: Ein Kräuterstrauß für alle Lebenslagen
Am 15. August begeht die katholische Kirche „Mariäs Aufnahme in den Himmel“, auch heute noch „Mariä Himmelfahrt“ genannt. In bayrischen Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung, im Saarland wie in Österreich ist der 15. August ein Feiertag. In vielen Gegenden wird an diesem Tag noch der alte Brauch der Kräuterweihe gepflegt. So auch im Pfarrverband Fasanerie/Feldmoching.
Seit über tausend Jahren werden an Mariä Himmelfahrt Heilkräuter zu einem Strauß gebunden, zum Gottesdienst gebracht und dort geweiht. Je nach Region wurden in den „Frauendreißiger Weihkräuterbuschen“, in den „Rauchkräuterbuschen“, den „Neunerbuschen“, den „Krautwisch“, „Würzwisch“ oder wie der Kräuterstrauß sonst hieß, sieben verschiedene Kräuter eingebunden (sieben als alte heilige Zahl) oder neun Kräuter (in Erinnerung an drei mal drei für die heilige Dreifaltigkeit). Bisweilen waren es auch 12 Kräuter (Anzahl der Apostel), 14 (die kirchlichen Nothelfer), 15 (Symbol für Altes und Neues Testament), 24 (für die zwölf Stämme Israel und die zwölf Apostel), 66, 72 (Zahl der Jünger Jesu), 77 oder 99. „Magische“ Zahlen sind bei diesem Strauß also immer im Spiel! Welcher Zahl man auch frönen mag, sieben verschiedene Heilkräuter, Getreideähren oder Blumen sollten es in jedem Fall sein. Seitens der Kirche gibt es keine Vorgaben.
Diese Pflanzen gehören in einen Kräuterstrauß
Einen Stress braucht man sich bei der Auswahl der Kräuter nicht zu machen. Denn in der Literatur gehen die Empfehlungen, welche Kräuter zu einem „richtigen“ Strauß gehören, auseinander. Die Liste der Möglichkeiten ist lang: Alant, Johanniskraut, Wermut, Beifuss, Rainfarn, Schafgarbe, Königskerze (immer in die Mitte binden), Kamille, Thymian, Baldrian, Odermennig, Eisenkraut, Golddistel, Harfheu… Man kann aber auch Getreidesorten nehmen sowie Glockenblumen, Margeriten, Arnika, Pfefferminze, Liebstöckel, Kümmel, Eberwurz, Johanniskraut und Eberraute oder geheimnisvoll klingende Pflanzen wie Tausendgüldenkraut, Fünffingerkraut, Bibernelle, Weinraute, Teufelsabbiss (Tormentil), Mooskolben, Bittersüßer Nachtschatten, Tauben-Skabiose, Jakobsgreiskraut… In manchen Gegenden nahm man früher einfach die Kräuter, die man bei der zweiten Mahd schnitt. Und wieder andere gaben zur Krönung des Straußes eine Lilie oder eine Rose dazu, um damit der Gottesmutter Maria zu huldigen. Die simple moderne Alternative: ein Strauß aus Blumen.
Dass die Kräuter just am 15. August gesegnet werden, hat einen tieferen Sinn. Früher begann mit Mariä Himmelfahrt die wichtigste Kräutersammelzeit des Jahres. Heilpflanzen, die bis zum 15. September gesammelt wurden, übertrafen angeblich alle anderen Kräuter an Kraft – mit Ausnahme der Johanniskräuter, die man zur Sommersonnenwende pflückte. Durch die Klimaverschiebung sind heute allerdings manche der empfohlenen Kräuter bereits verblüht.
Heilbringende Pflanzen vor der Haustür
Die Kräuterbuschen wurden in den „Herrgottswinkel“ gegeben oder nach unten hängend beziehungsweise in einer Blumenvase getrocknet. Ein Tee aus den geweihten Kräutern galt als heilsam. Heilkräftig war es auch, wenn man die getrockneten Kräuter zerrieb, mit Weihrauch vermischte und das Krankenzimmer damit räucherte. Ferner sollten die Kräuter für Eheglück, Kindersegen und gute Ernte sorgen – viele verstreuen noch heute die getrockneten und zerriebenen Kräuter in ihren Gärten und auf die Felder. Krankem Vieh mischte der Bauer die geweihten Kräuter ins Futter. Und bei einem Gewitter warf man zum Schutz vor Blitzschlag einige Kräuter ins offene Feuer. Damals brauchte man also noch kein Kristallsalz vom Himalaya, kein Aloe Vera aus Südamerika, kein Ginseng aus China oder Teebaumöl aus Australien. Das jahrhunderte alte Wissen um Heilpflanzen und die Erfahrungen der Vorfahren damit waren in den Familien noch lebendig.
Blumen zeigen die Schönheit der Schöpfung
Kräuter und Klöster gehörten viele Jahrhunderte zusammen. Denn vom 8. bis zum 13. Jahrhundert waren die Mönche für die medizinische Versorgung der Bevölkerung verantwortlich. Die Klosterheilkunde brachte umfangreiche Schriften hervor, man denke nur an die Werke der Hildegard von Bingen und an den „Macer floridus“, im Mittelalter das Standardwerk der Kräuterheilkunde. Der Mönch Odo Magdunensis aus dem Loire-Tal beschrieb darin die Heilkräfte von 77 Pflanzen.
In der Theologie wird die Verknüpfung der Kräutersegnung mit Maria wie folgt erklärt: Die Heilkraft der Kräuter soll durch die Fürbitte der Kirche dem ganzen Menschen zum Heil dienen. Dieses Heil ist an Maria besonders deutlich geworden. Der Segen lautet: „Herr, unser Gott, du hast Maria über alle Geschöpfe erhoben und sie in den Himmel aufgenommen. An ihrem Fest danken wir dir für alle Wunder deiner Schöpfung. Durch die Heilkräuter und Blumen schenkst du uns Gesundheit und Freude. Segne diese Kräuter und Blumen. Sie erinnern uns an deine Herrlichkeit und an den Reichtum deines Lebens. Schenke uns auf die Fürsprache Mariens dein Heil. Lass uns zur ewigen Gemeinschaft mit dir gelangen und dereinst einstimmen in das Lob der ganzen Schöpfung, die dich preist durch deinen Sohn Jesus Christus in alle Ewigkeit.“
Sicherstellung des Schulsports in der Grund-/Mittelschule Eduard-Spranger-Str.
Auf der letzten öffentlichen Sitzung des Bezirksausschusses vor der Sommerpause erläuterte BA-Vorsitzender Markus Auerbach den BA-Mitgliedern und den anwesenden Bürgern kurz, wie das Schulreferat sich die zeitliche Abfolge von Abriss und Neubau der Grund-/Mittelschule an der Eduard-Spranger-Schule vorstellt. In den Plänen der aktuellen Machbarkeitsstudie zum abschnittweisen Vorgehen wird die Turnhalle als erstes beseitigt und eine neue Halle nach etwa drei Jahren Bauzeit wieder zur Verfügung stehen. Daher willdas Gremium das Schulreferat darum bitten, dass auch während des sukzessiven Abrisses und Neubaus der Grund-/Mittelschule an der Eduard-Spranger-Str. der Turnunterricht gewährleistet bleibt. Insbesondere soll geprüft werden, ob etwa auf der geteerten Sportfläche in der Grünanlage an der Gundermannstr. – südwestlich des Schulgeländes – ein Provisorium aufgestellt werden kann.
Die Turnhalle wird zum einen ja nicht nur für den Turnunterricht gebraucht, sondern auch für Veranstaltungen und Abschlussprüfungen genutzt. Sportunterricht anderswohin in den Münchner Norden zu verlagern, sei unpraktikabel, weil bei längerer Anreise von den Sportstunden nur noch ein unverhältnismäßig kurzes Fragment übrig bleibe. Als Mittel der Wahl erscheint den BA-Mitgliedern die Errichtung eines Provisoriums in nächster Nähe – nicht zuletzt deshalb, damit auch die örtlichen Sportvereine weiter eine Halle haben.